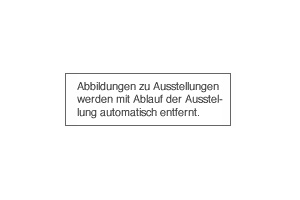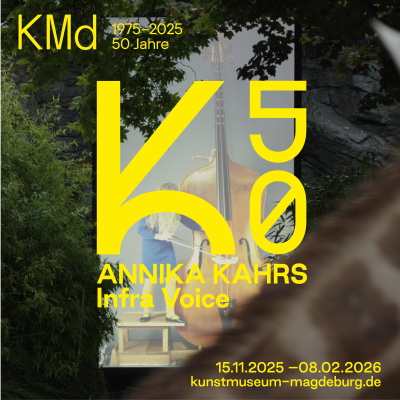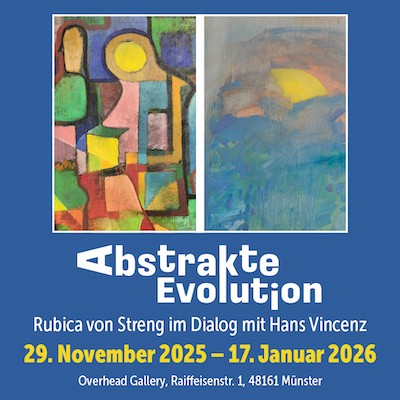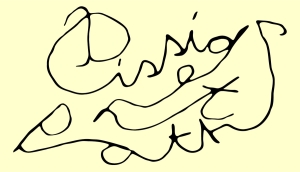Fleur du mal, um 1890
Blume des Bösen
Kohle und schwarze Kreide auf Papier
39,2 × 35,5 cm
Sammlung Scharf-Gerstenberg, Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin
Foto: bpk / Sammlung Scharf-Gerstenberg / Roman März
Meine Imagination, eine ephemere Fatamorgana: Lord Voldemort, endlich mit Nase unterwegs, ist zum Verführer geworden, zum Schönling, zum galanten Zauberer im schwarzen Paillettenkleid (für alle Nicht-Harry-Potter-Fans: Voldemort ist der Böse ohne Nase). Er ist der „Joker“, der auf den entbrannten Autos tanzt – aus reiner Selbstzerstörung. Heute verschenkt er einen Blumenstrauß, also tote Blumen: Danke, Voldemort!
Blütenköpfe von Dahlien, Lilien und Chrysanthemen. Ein bunter Zauber, fragile Linien, dünne, weiche Blätter. Sanfte Gerüche, Wolken aus Pollen, dichter Dunst des Vergänglichen, Odem der Verwesung. Die Blumenleichen verenden in der Vase. Wir haben den Tod zu Gast.
Ein schöner Voldemort mit Blumenstrauß ist die simpelste Parabel auf das berühmte Buch Les Fleurs du Mal von Charles Baudelaire (1857). In diesem Buch sind rund 100 Gedichte versammelt, die als Gesamtwerk zum Ausdruck ihrer eigenen Epoche wurden: die szenischen Bilder beschreiben das 19. Jahrhundert in seiner melancholischen Schwere, seinen puderigen Rußschichten über allem, seiner erotischen Reizbarkeit und dem Traum einer maschinisierten Moderne. Noch heute werden Künstler*innen von den starken Sprachbildern inspiriert. Grundidee ist, das Schöne vom Guten zu entkoppeln, andersherum: Das Böse und Schlechte, Müde, Tote, Kranke mit dem Schönen zu verbinden.
Die Texte von Baudelaire und ein gleichnamiges Gemälde von Odilon Redon (1890) werden zum Ausgangspunkt der aktuellen Themenausstellung in der Sammlung Scharf-Gerstenberg. Die Ausstellung versammelt in rund 8 Kapiteln Werke der letzten 150 Jahre.
Wie das Buch heißt auch eine Rauminstallation von Otto Piene (1969), wo unter ohrenbetäubendem Krach und Stroboskop-Licht schwarze Luftballonblumen aufgeblasen werden und sich aufrichten. Der Bezug ist dagegen eher indirekt bei drei imposanten Fotografien von Gundula Schulze Eldowy aus der Serie Mumien (2016), wo es um Verwesung und Verfall geht. Immer wieder wird mit den Ähnlichkeiten zwischen Pflanzen und menschlichen Geschlechtsteilen gespielt. Besonders toll dargestellt in einem getrockneten Kaktus von Julius von Bismarck (2022), der einer Vagina gleicht. Auch Fatoş Irwen spielt in seiner Arbeit (2018) mit dem Blumendekor eines Kopfkissenbezugs, das um Darstellungen einzelner Körperteile ergänzt wird. Andernorts verbindet Kurt Seligmann in einer Fotomontage (1935) einen Geschlechtsakt mit zwei leicht bekleideten Personen, die einem pilzartigen Phantasma entgegenlaufen.

Le calvaire. Die Kreuzigung
Aus der Serie Les Sataniques, ca. 1882
Radierung und Heliogravüre, koloriert
35 × 25 cm (Blatt)
26,2 × 18,4 cm (Motiv)
Sammlung Scharf-Gerstenberg, Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin
Foto: Sammlung Scharf-Gerstenberg / Dietmar Katz
Ganz direkt sind die Bezüge vor allem zu Beginn der Ausstellung, wo Zeichnungen von Félicien Rops zu sehen sind (um 1880), der die zweite Auflage des Buches illustrierte. Er vereint Tod und Erotik, also nackte Frauen über gekreuzigten Leichenkörpern mit Erektion. Nun ja, classy Femme fatale, die böse Verführerin. In der Ausstellung erscheint sie in einem Werk von René Magritte (1946) oder etwas verkopfter bei Paul Klee (1920).
Das Buch war zu seiner Zeit sicherlich wegweisend, vor allem auch sprachlich ein Meisterwerk. Dennoch bedient es für unseren heutigen Wissensstand eine problematische Matrix, die in der Ausstellung immer wieder reproduziert wird. Schade ist, dass nirgendwo wirklich erklärt wird, warum dieses Buch für uns heute relevant ist. Was sind unsere Blumen des Bösen oder die schönen Bösen?
Ein porträtierter Albtraum ist die Fotoreihe Aus den Gärten des Grauens (2019) von Ulf Soltau. Sie zeigen Vorgärten von heute. Eine fiese Dystopie, wo Natur domestiziert wird. Unorte, die abweisend wirken wie von dem Einrichtungshaus Depot bestückte Friedhöfe. Selbst die bösesten Blumen sind hier vermutlich schon verwelkt. In dieser Sektion – und an einer späteren Stelle – treten auch zwei starke kuratorische Eingriffe zutage: Neben einem kleinformatigen Gemälde von Carl Spitzweg (1855), wo ein Pfarrer seine Kakteen hegt und pflegt, hängt ein gleichgroßes Foto einer rosa gekleideten Frau vor einer Wand aus Kakteen (Fotograf*in unbekannt). An anderer Stelle werden zwei Filme von Leni Riefenstahl nebeneinander präsentiert. Der eine Film aus den 30er Jahren zeigt einen Aufmarsch von Nationalsozialisten, der zweite Film aus den 2000ern eine Naturaufnahme von Fischschwärmen. Beide Filme spielen mit einer Ästhetik der Masse. Die Gegenüberstellung wirkt wie ein künstlerisches Statement – aber haben Spitzweg und Riefenstahl das gewollt? Vermutlich nicht: An beiden Stellen wird nicht vermittelt, dass diese Nachbarschaft heute gesetzt wurde – und eigentlich wäre doch genau dies der Moment gewesen, wo die Kuration hätte veranschaulichen können, was Baudelaires Buch Les Fleurs du Malauch 2024 aktuell macht!?
Böse Blumen
12.12.2024 bis 04.05.2025
Eine Sammlungspräsentation der Nationalgalerie – Staatliche Museen zu Berlin
Öffnungszeiten: Di – Fr 10 – 18 Uhr, Sa + So 11 – 18 Uhr
Sammlung Scharf-Gerstenberg
Schloßstraße 70, 14059 Berlin-Charlottenburg
www.smb.museum