19–22 Uhr: Preisträger:innen der Goethe-Medaille über Kultur, Bildung, Zivilgesellschaft. Mit: David Van Reybrouck, Osman Kavala, Ayse Bugra, Li Yuan, Shelly Kupferberg (Mod.) Humboldt Forum /Saal 3 | Schloßplatz, 10178 Berlin
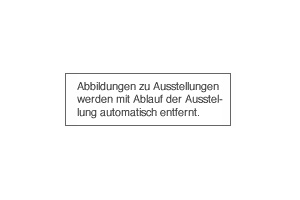
„Mein Museum existiert nicht. Es ist nur eine Frage“. Genau genommen ist es ein ganzer Fragenkatalog, den Meschac Gaba mit seiner Rauminstallation „Museum of Contemporary African Art“ aufwirft.
In Contonou (Benin) geboren und in Rotterdam lebend, kennt der 53-jährige Künstler die Kunstwelt von „innen“ wie von „außen“. Folglich ist er auch mit dem Begriff der Kunstgeschichte vertraut, und er sieht die Grenzen dieses westlichen Konzepts. Ein Konzept mit universellem Anspruch - ähnlich dem des „Museums“, in welchem wir künstlerisches Schaffen nach Epochen und Kulturen kategorisieren. Und das wirft Fragen auf. Wie steht es um das zeitgenössische Kunstschaffen in einer globalisierten Welt? In einer Welt, in der sich ehemals getrennte Kulturen berühren, befragen, befruchten oder beharken? Hat der universale Gültigkeitsanspruch der Moderne Bestand? Hatte er je Bestand? Welche Rolle spielen die kulturellen Wurzeln in einer sich global gebenden Kunstszene heute?
Was zum Beispiel bedeutet es, von „afrikanischer Gegenwartskunst“ zu sprechen. Falls es sie überhaupt gibt, wie kann man sie adäquat präsentieren? Vielleicht im Museum? Und ist die Kunst eines Künstlers afrikanischen Ursprungs zwingendermaßen „afrikanische Kunst“? Wo verläuft die Grenzlinie zwischen Ethnographie und Kunst? Die Liste möglicher Fragen ließe sich endlos fortsetzen.
Gabas „Museum of Contemporary Art“, das der Künstler bereits 1997 während seiner Studienzeit an der Rijksakademie in Amsterdam zu entwickeln begann, ist der größte Ankauf, den die Tate Gallery in London jemals getätigt hat. Ein deutliches und mutiges Zeichen, denn das „Museum im Museum“ birgt eine subversive Kraft, provoziert traditionelle abendländische Denkmuster.
Bis zum 16. November 2014 sind sieben der zwölf Räume in der KunstHalle der Deutschen Bank in Berlin zu sehen. Neben einem Museums-Shop, einer Bibliothek und einem Restaurant finden sich dort auch Räume, die den Begriff des Musealen untersuchen und erweitern: ein Architecture Room, ein Draft Room und ein Art und Religion Room. Dabei ist dem Künstler wichtig, dass sich sein Museum weiterentwickelt, sich den lokalen Gegebenheiten anpasst, in Dialog tritt mit einer Stadt.
Während im Museumsshop unter anderem Objekte und Skulpturen von Gabas Künstlerfreunden erstanden werden können, kochen im Restaurant Künstler an zwei Abenden für die Besucher. Der Begriff des Museums und der (afrikanischen) Kunst wird so in alle Richtungen hin ausgedehnt.
In der Bibliothek befinden sich Bücher von Kuratoren, mit denen Gaba zusammengearbeitet hat. Noch persönlicher ist der Bezug zu einem Sarg in der Ecke des Raumes. Eine Tonaufnahme gibt die Lebensgeschichte des Künstlers wieder, imaginär erzählt von dem verstorbenen Vater. Über einem Tisch hängen Leuchter mit verbrannten Büchern. Gaba stützt sich dabei auf ein afrikanisches Sprichwort, das besagt: „Wenn ein alter Mensch stirbt, ist es so, als ob eine Bibliothek niederbrennt.“
Im Draft Room dreht sich alles um die Wertigkeiten einer Konsumgesellschaft. „Geld ist den Menschen am wichtigsten. Sehen sie Geld, fangen sie an nachzudenken“, erklärt der Künstler. Hühnerschenkel in einer überbordenden Tiefkühltruhe – in kapitalistischen Ökonomien übersteigt die Produktion den Konsum - und Geldnoten dominieren den Raum. Doch die unzähligen Scheine, teils sorgfältig gestapelt, teils zu Konfetti gestanzt, sind wertlos.
Im Kunst- und Religionsraum sagt eine professionelle Tarotkartenleserin neugierigen Besuchern die Zukunft voraus. Sie sitzt im Zentrum einer kreuzförmigen Konstruktion, die an einen Marktstand erinnert. In den sie umgebenden Regalen finden sich Gottheiten und Symbole aus den Weltreligionen – vom indischen Elefantengott Ganesha über den jüdischen Gebetschal bis hin zur Madonna mit dem Kind. Ergänzt werden diese Objekte durch banale Dinge wie einen Rückspiegel oder eine Brosche. Hier spielt Gaba auf die Präsentation afrikanischer Kultgegenstände im Völkerkundemuseum an. Afrikanische Kulturen werden dort in der Regel als statisch präsentiert, ihre Artefakte einfach nur als ästhetische, oft auch nur exotisch interessante Gegenstände „ausgestellt“. Dem überkommenen Verständnis nach hat die afrikanische Kunst in den Vitrinen „authentisch“ zu sein, und meist ist damit „historisch“ gemeint. Wo sich in diesem vorherrschenden System jene Kunst wiederfindet, die lebendigen Kulturen entspringt oder dem globalisierten Ineinanderfließen kultureller Einflüsse, das bleibt die Frage.
In den öffentlichen Raum führt die letzte „Abteilung“ des Museums, die „Humanist Space“: Acht goldene Fahrräder mit dem Logo des Museum of Contemporary African Art – hundert von ihnen waren bereits auf der Documenta XI im Einsatz, um Geld für humanitäre Projekte in Afrika zu sammeln - können nun auch in Berlin ausgeliehen werden.
Gaba ermuntert andere Künstler, sich von der überholten Idee des Museums freizumachen: „Man braucht keine vier Wände, um seinen eigenen Platz zu definieren und zu entscheiden, wer man ist.“
Deutsche Bank KunstHalle
Unter den Linden 13/ 15
deutsche-bank-kunsthalle.de
Öffnungszeiten 10-20 Uhr
Titel zum Thema Meschac Gaba:
Meschac Gaba: Museum of Contemporary African Art
Ausstellungsbesprechung: „Mein Museum existiert nicht. Es ist nur eine Frage“. Genau genommen ist es ein ganzer Fragenkatalog, den Meschac Gaba mit seiner Rauminstallation „Museum of Contemporary African Art“ aufwirft.

Freundeskreis Willy-Brandt-Haus e.V.
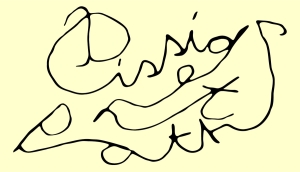
neue Gesellschaft für bildende Kunst (nGbK)

Japanisch-Deutsches Zentrum Berlin

Galerie im Körnerpark

Kunstbrücke am Wildenbruch