
17 Uhr: mit Theresa Schubert (Künstlerin) und Ingeborg Reichle (Kunsthistorikerin / Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit Helmholtz-Zentrum Potsdam). Projektraum MEINBLAU, Christinenstr. 18-19, 10119 Berlin
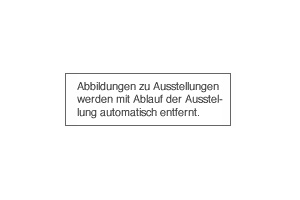
Innenstadt, 1010 Wien
© BRUSEUM / Neue Galerie Graz, Universalmuseum Joanneum; Foto: Ludwig Hoffenreich
West-Berlin war Ende der 1960er Jahre Zufluchtsort für den österreichischen Künstler Günter Brus und seiner Familie. Seine provokanten Aktionen in Wien hatten ihn zum Feindbild von Öffentlichkeit und Staat gemacht. Nun führt eine Werkübersicht im Martin-Gropius-Bau als erste museale Ausstellung durch ein künstlerisch und politisch bewegtes Leben, zeigt wichtige Stationen des ehemaligen enfant terrible und präsentiert in Schwerpunkten sein multimediales Werk als Maler, Zeichner und Bild-Dichter.
Es war ein langer, störungsreicher Weg, den der 1938 in der Steiermark geborene und heute in Graz lebende Günter Brus von seiner radikalen Körperkunst bis hin zum Träger des Großen Österreichischen Staatspreises, 1997 für sein Gesamtwerk verliehen, zurücklegte.
Nicht zu zählen seien die Arbeiten, so die Kuratorin Britta Schmitz, ein Werkverzeichnis gäbe es nicht. Ihre Auswahl führe durch das multimediale Lebenswerk des immer noch aktiven Künstlers, suche die Verbindung zu den frühen, spektakulären Aktionen. Es ist eine Ausstellung entstanden, deren Exponate vielleicht nicht mehr provozieren, aber nach wie vor irritieren und nachdenklich stimmen.
Bereits nach zwei Jahren bricht Brus 1960 das Studium an der Akademie für angewandte Kunst in Wien ab, setzt sich mit dem internationalen Informel (ohne Titel, 1960/61, Tusche auf Papier) und Experimentalfilmen (Pullover 1967, 16mm Film, 1:08 Minuten, Kamera Helmut Kronberger) auseinander, entdeckt seinen eigenen Körper als künstlerisches Medium. 1964 finden die ersten Aktionen im Atelier von Otto Mühl in Wien statt (Selbstbemalung I, 1964/84, 15 s/w Fotografien; Selbstbemalung II, 1964, 20 s/w Fotografien). Günter Brus und seine Frau Anni sind die Akteure, ohne Publikum, dokumentiert durch Fotografen und Filmemacher. Erstmals bei seinem Wiener Spaziergang 1965 präsentierte sich Brus als weiß bemaltes, lebendiges, zweigeteiltes Bild (Wiener Spaziergang, 1965/1989, 16 schwarz-weiß Fotografien von Ludwig Hoffenreich). Die Polizei verhindert die Aktion, die provokanten schwarzen Streifen über Kleidung, Gesicht und Haare „stören die öffentliche Ordnung.“
Es sollten noch viele dieser Störungen folgen, doch Brus verstört nicht nur die Öffentlichkeit, er setzt sich selbst immer extremer werdenden körperlichen Zuständen aus. 1970 findet die letzte und radikalste Aktion in München statt, die Zerreißprobe (Zerreißprobe, 1970/2001, 12 Farbfotografien). Der Künstler fügt sich starke Verletzungen zu, er blutet, uriniert, wälzt sich zuckend auf dem Boden. „Mein Körper ist die Absicht, mein Körper ist das Ereignis, mein Körper ist das Ergebnis.“ So formuliert Brus, der seinen Körper zum einzigen Medium seiner Kunst erklärt, den Kampf gegen die erdrückenden und verlogenen Strukturen der Zeit. Heute beurteilt er diese Körperverletzungen auch biografisch: es sei eine „Mischung innerer Verletzungen und kunsttheoretischer Überlegungen“ gewesen.

© Sammlung Peter Raue; Foto: Thomas Bruns
Nach der Zerreißprobe entschließt sich Günter Brus 1971, „diesen Weg nicht weiterzugehen. Papier wird mein Schauplatz“. Doch dies nicht minder exzessiv, die Anzahl der Arbeiten geht in die Zehntausende. Brus verbindet Text und Bild, als erste Arbeit, noch im Berliner Exil, entsteht Irrwisch (Kohlkunstverlag, Frankfurt a.M., 1971). In der Ausstellung zeigt Britta Schmitz den Zyklus, weit über 100 Blätter, gerahmt an einer Wand, um sie in ihrer Komplexität sprechen zu lassen. Die Bild-Dichtungen suchen zu den Selbstverletzungen seiner aktivistischen Zeit eine Sprache, Brus will sich „die Sprache vom Leib wegschreiben“. Die schwarz-weißen Zeichnungen zeigen wieder Körperverletzungen und sexuelle Themen. 1972 holt Harald Szeemann die Sammlung loser Blätter ohne bestimmte Reihenfolge auf die Documenta V.

5-teilge Bilddichtung
Ölkreide auf Packpapier, je 106 x 79 cm
© Privatsammlung Graz
Es folgen Werke wie La Croce del Veneto (1973-74, 9-teilige Arbeit), Des Knaben Wunderhorn, 1979 in der Daadgalerie in der Berliner Kurfürstenstraße ausgestellt, der Zyklus Zyankal-Zyklamen (1982/83, 5-teilige Bilddichtung, Ölkreide auf Packpapier) oder Ich treibe nur in Störungszonen (1985): Eine menschliche Figur, der Körper aufgelöst und deformiert, zwischen den Bildgrenzen gefangen. Diese Arbeit gab der Berliner Ausstellung den Titel.
Die Ausstellung zeigt bis zum Juni überzeugend und sehr eindrücklich, dass Günter Brus weit mehr ist und war als der provozierende Aktionist. Sein Statement „Ich verlasse die Leinwand“ gilt für das gesamte Werk, Brus sprengte Bild(er)-Räume, überschritt Grenzen der Malerei und verfügt über eine unermüdliche Energie. „Ich geh als Kunstwerk spazieren“ sagt Günter Brus; er bewegt das Publikum bis heute.
Günter Brus. Störungszonen
12. März bis 6. Juni 2016
Mi – Mo 10 – 19 Uhr; an den Feiertagen geöffnet, Sonderöffnung Dienstag, 12.04., 10-19 Uhr
Martin-Gropius-Bau Berlin
Niederkirchnerstraße 7
10963 Berlin
gropiusbau.de
Titel zum Thema Günter Brus:
Bild-Störungen - Günter Brus im Martin-Gropius-Bau Berlin
Ausstellungsbesprechung: West-Berlin war Ende der 1960er Jahre Zufluchtsort für den österreichischen Künstler Günter Brus und seiner Familie.


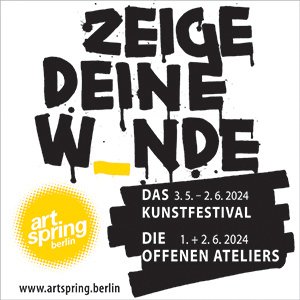
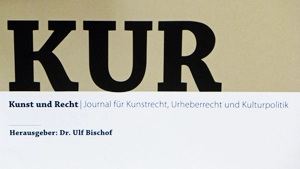
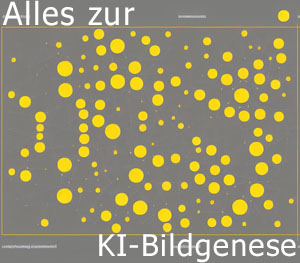

Alfred Ehrhardt Stiftung
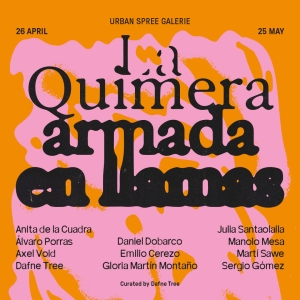
Urban Spree Galerie

Japanisch-Deutsches Zentrum Berlin
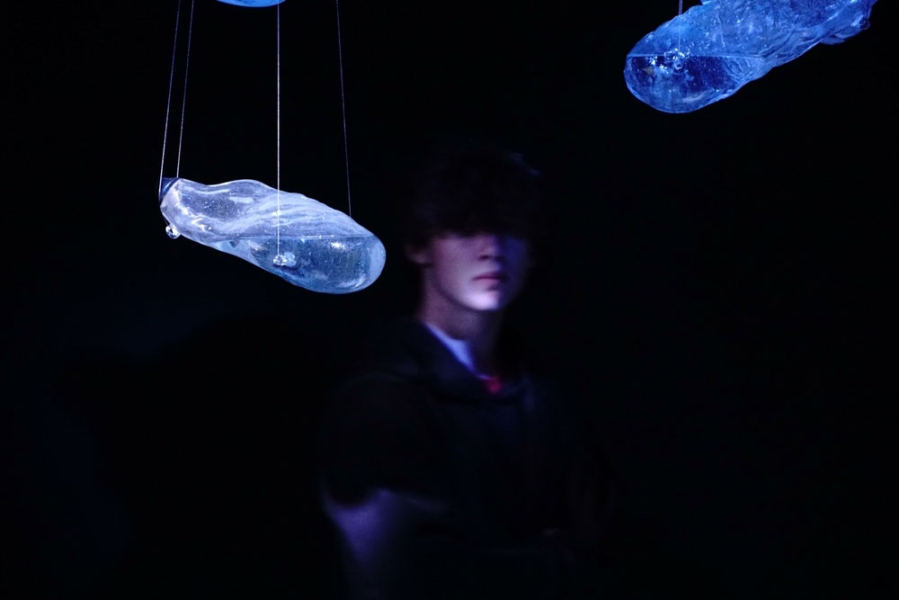
Meinblau Projektraum
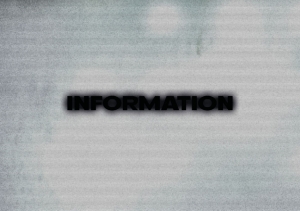
Galerie HOTO