19–22 Uhr: Preisträger:innen der Goethe-Medaille über Kultur, Bildung, Zivilgesellschaft. Mit: David Van Reybrouck, Osman Kavala, Ayse Bugra, Li Yuan, Shelly Kupferberg (Mod.) Humboldt Forum /Saal 3 | Schloßplatz, 10178 Berlin
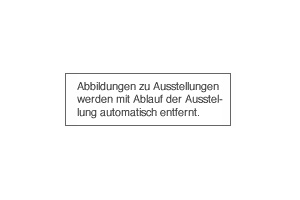
Ein paar gedämpfte Geräusche sind zu hören: ein Husten, ein Flugzeug, ein Kind, dazu ein kontinuierliches, technisch bedingtes Rauschen. Yoko Ono ist nicht zu hören. Ohne einen Ton hervorzubringen, aber unter großem körperlichen Einsatz singt sie ins Mikrofon, die Worte werden eher physisch empfunden als verbal artikuliert. Schließlich beenden sie, John Lennon – an der Luftgitarre – und zwei Mitglieder der Band Elephant's Memory die Darstellung und verschwinden. Die Performance Silent Piece fand am 16. September 1972 während der Gedenkfeier für den Happening- und Performancekünstler Ken Dewey statt, der im Alter von 38 Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Gefilmt wurde die Performance von Aldo Tambellini, seinerseits Pionier des Expanded Cinema, der Electromedia Performance und der Videokunst. Die letzten fünf Jahrzehnte schlummerte der wenige Minuten dauernde Film in den Tiefen von Tambellinis Videoarchiv, bis dieses im November 2024 an das ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe übergeben wurde. Bei der Digitalisierung des mehr als 500 Bänder umfassenden Konvoluts stießen die Restaurator*innen auf die Dokumentation von Silent Piece, die nun in digitalisierter Form erstmals öffentlich zu sehen ist. Eine Sensation also und nur eines der vielen Highlights der umfangreichen, vielschichtigen Ausstellung The Story That Never Ends. Die Sammlung des ZKM.
Die Präsentation ist ein Blick ins Familienalbum der Medienkunst, ein Streifzug durch sieben Jahrzehnte Kunstgeschichte, geschrieben anhand von Fotografien, Videokunst, Licht-/Klanginstallationen, kinetischen Objekten, interaktiven Werken und solchen, die mit Künstlicher Intelligenz geschaffen wurden. Yoko Ono (*1933) neben der jüngst verstorbenen Videokunst-Pionierin Dara Birnbaum (1946-2025), Peter Weibel (1944-2023) und Bruce Naumann (*1941).
In der Kunstgeschichte ist der höchste Adelstitel jener der Mutter und des Vaters; das Kaiserpaar ist vertreten: Von Shigeko Kubota (1937-2015), „Mutter der Videokunst“, ist die 1-Kanal-Videoskulptur Duchampiana: Nude Descending a Staircase (1991/1996) zu sehen, in der die japanische Künstlerin das bekannte Gemälde Duchamps in Raum und Zeit transformiert. Ihr männliches Pendant, Nam June Paik (1932-2006), „Vater der Videokunst“, ist mit Canopus (1990) vertreten, das sein Arbeiten mit Kommunikationstechnologien veranschaulicht.
Mit Gaussian-Quadratic (1963) von A. Michael Noll (*1939) ist eines der frühesten computergenerierten visuellen Kunstwerke weltweit zu sehen. In seiner unmittelbaren Nähe die Werke von Vera Molnar (1924-2023), einer der wenigen Pionierinnen der computergenerierten Kunst: Molnar setzte schon ab Ende der 1960er Jahre Großrechner ein, um ihre Werk zu konzipierten. Weitere Grandes Dames sind vertreten, so zum Beispiel Rebecca Horn, Ulrike Rosenbach, Lily Greenham und Lynn Hershman Leeson. Ihre komplexe interaktive Installation America’s Finest (1993-1994) thematisiert nicht nur Waffengewalt und die Darstellung von Krieg in den Medien, sondern auch die Verantwortung des Einzelnen sowie die Konsequenzen, die sich aus den Überwachungstechnologien ergeben.

Viele der Werke veranschaulichen, wie Künstler*innen sich mit neuen Medien auseinandersetzen, ihre Möglichkeiten und Auswirkungen untersuchen und so „neue soziale und kulturelle Narrative hervorbringen, die den Diskurs über unser Verhältnis zu Technologie bereichern“, so Clara Runge, Kuratorin am ZKM.
So antizipiert beispielsweise die interaktive computerbasierte Installation Touch me (1995) von Alba D’Urbano (*1955) die heute sehr aktuelle Veränderung der Selbstwahrnehmung durch den Einsatz digitaler Medien und die interaktive AR-Installtion Virtual Sculpture (1981/2025) von Jeffrey Shaw (*1944) und Theo Botschuijver (*1943) gilt als Vorläufer der Augmented-Reality-Systeme, die rund 20 Jahre nach der ursprünglichen Konzeption des Werks auf den Markt kamen. In der Installation, einer medienarchäologischen Rekonstruktion der nicht erhaltenen ersten Fassung, können die Besuchenden durch einen Röhrenmonitor auf die Umgebung schauen, in der ein animiertes, virtuelles Objekt erscheint.
Immer wieder lassen die Exponate und ihre Kontextualisierungen die Besuchenden an wichtigen Momenten der Medienkunstgeschichte teilhaben, so beispielsweise im Zusammenhang mit dem Werk Que pensez-vous de la recherche esthétique fait à l’aide d’un ordinateur? (Was halten Sie von der ästhetischen Forschung mithilfe eines Computers?) (1971) von Manfred Mohr (*1938): Zu der Beantwortung dieser Frage lud der Künstler die Besuchenden seiner Ausstellung ein, die 1971 im Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris stattfand. Die Schau gilt als erste Einzelausstellung von Computerkunst und präsentierte geplottete, algorithmisch erzeugte Zeichnungen, die sich aus eingespeisten Daten des französischen Wetterdienstes ergaben. Das im ZKM zu sehende, wild bekritzelte Papier gibt Antworten, die sich auch ins Heute übertragen lassen. Beispielsweise bei der Frage nach Autor*innenschaft, wenn KI an der Produktion von Kunst beteiligt ist: „Ask the computer what it thinks“, „je préfère la pensée vraie humaine l’important est de ne pas programmer l’homme.“ („Ich bevorzuge den tatsächlich menschlichen Gedanken, das Wichtige ist, nicht den Menschen zu programmieren“) oder auch „Man sollte der Maschine in den Arsch treten!!!!“
Mit dieser Ebene – den Werken, die uns durch die Geschichte der Medienkunst lotsen – ist jedoch nur eine Schicht der Sammlungspräsentation beschrieben. „Diese Ausstellung rückt die komplexe Arbeit hinter den Kulissen des ZKM in den Mittelpunkt“, so Alistair Hudson, wissenschaftlich-künstlerischer Leiter des ZKM. Dabei spielt der Titel The Story That Never Ends nicht nur auf die künstlerischen Entwicklungen des 20. und 21. Jahrhunderts an, sondern auch auf die Herausforderungen, denen Museen, die Medienkunst sammeln, begegnen. Und mit diesen Herausforderungen kennt sich das ZKM als „angesehenste Medienkunstsammlung der Welt“ (Hudson) bestens aus. Aufgrund der technischen und wissenschaftlichen Expertise, über die das Team des ZKM verfügt, gilt das Haus als wichtige Adresse, wenn es um die Restaurierung, Konservierung und Bewahrung von Medienkunstwerken geht. Um die Arbeit des interdisziplinären Teams im Bereich Restaurierung zu würdigen, gibt die Schau den Blick der Restaurator*innen wider. Sie wählten Schlüsselwerke aus, die aufgrund ihrer komplexen Restaurierung teilweise Jahrzehnte nicht mehr ausgestellt wurden, darunter Marie-Jo Lafontaines (*1950, Antwerpen) monumentale Videoskulptur Les l’armes d’acier (1987). Hier kommen technisch veraltete Komponenten zum Einsatz, die heute nicht mehr hergestellt werden, die jedoch dank des großen Vorrats von Ersatzteilen und -geräten am ZKM ersetzt werden konnten. Aus konservatorischer Sicht ist jedoch noch keine „zufriedenstellend Langzeitalternative“ gefunden worden, informiert die Infotafel vor dem Werk.

Les l’armes d’acier ist eines von sieben Schlüsselwerken der Medienkunst, die im Zuge eines Restaurierungsprojekts mit der Wüstenrot Stiftung restauriert wurden und nun erstmals seit Langem wieder zu sehen sind. Ein weiteres ist Sémaphora III (1966) von Edmond Couchot (1932-2020), das jedoch auch konservatorischen Gründen nur zweimal am Tag aktiviert werden kann. Die meiste Zeit schweigt das kybernetische Objekt; auf einem Bildschirm ist eine Aufnahme des „mobile musical“ ist Aktion zu sehen und zu hören: Die auf einer Platte angebrachten Holzstücke und Acrylglasstücke bewegen sich, Glühbirnen leuchten, dazu eine collagierte Tonspur – es ist, als hätte Couchot ein Merzbild von Kurt Schwitters zum Leben erweckt.
Nicht nur die Infotafel der betreffenden Werke geben Einblicke in die komplexe und oftmals noch nicht final abgeschlossene Restaurierung der Werke, auch mehrere Info-Stationen lassen die Arbeit der Restaurator*innen greifbarer werden. Diese Stationen eröffnen eine weitere Ebene der Ausstellung, die einen zusätzlichen Blick in die Technikgeschichte gibt, und den enormen Aufwand verdeutlicht, der der Präsentation der Werke vorausgeht. Es wird nachvollziehbar, weshalb viele private und öffentliche Sammlungen davor scheuen, Medienkunst zu sammeln und weshalb das ZKM für viele Künstler*innen eine wichtige Anlaufstelle ist, wenn es darum geht, das eigene Archiv zu bewahren. So beheimatet das ZKM 236 Archive von Künstler*innen, u. a. jenes der Medienkünstlerin Annegret Soltau (*1946) mit 81 Bändern, von denen in der Ausstellung Los-Lösung II (1977), Begegnung (1978) und schwanger-sein II (Ausschnitt: 3. Phase: Hoffnung) (1979/1981) zu sehen sind.

Dara Birnbaum, »Technology / Transformation: Wonder Woman«, 1978, Videostill des Videos, ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe
Insgesamt sind in der Ausstellung 129 Kunstwerke zu sehen, was gerade einmal 0,98% der Sammlung des ZKM ausmacht. Die Sammlung und die Archive nehmen zusammen eine Fläche von 21 Tennisplätzen ein, wie wir im sogenannten Living Room erfahren. In diesem offenen Raum mit vielen Sitzgelegenheiten lädt eine für die Ausstellung zusammengestellte Bibliothek zum Lesen ein. An der Wand hängen zahlreiche Bilderrahmen, darin liebevoll gestaltete Grafiken, die zusätzliche Informationen
geben: Das schwerste Werk: Bill Violas Stations (1994), ein Meilenstein der Medienkunst und so schwer wie der kleine asiatische Elefant Indra, der im Karlsruher Zoo lebt. Das kleinste Objekt der Sammlung, Das Kleinste Buch der Welt, Gutenberg-Museum (Hg.) (um 1970), ist gerade mal 0,35x0,35x0,15 cm groß.
Es gibt also viel zu entdecken: von der Entwicklung der Medienkunstgeschichte, über die Arbeit hinter den Kulissen bis hin zu Fun Facts der Sammlung des ZKM. Ein Besuch ist empfohlen, zwei Besuche wären besser.
ZKM | Zentrum für Kunst und Medien
Lorenzstraße 19
76135 Karlsruhe
+49 (0) 721 - 8100 - 1200
zkm.de
Titel zum Thema zkm:
Ein Blick ins Familienalbum der Medienkunst. Die Sammlungspräsentation am ZKM
Gastbeitrag: Ferial Nadja Karrasch berichtet aus dem ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe.
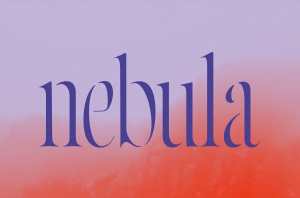
Galerie im Saalbau

Kunstbrücke am Wildenbruch

Verein Berliner Künstler

Kommunale Galerie Berlin

Freundeskreis Willy-Brandt-Haus e.V.