23:30 Uhr: Die Klangkünstlerin Darla Quintana präsentiert ihr Projekt ALMA, das eine Brücke zwischen Kunst, Technologie und gesellschaftlichem Denken schafft – und akustische Portale öffnet. Radialsystem | Holzmarktstr. 33 | 10243 Berlin

Leonora Carringtons fantastisches Oeuvre, aber auch ihr, gelinde gesagt, turbulentes Leben gilt es (wieder) zu entdecken.
Die Bilder der britisch-mexikanischen Künstlerin sind keine leichte Kost. Auf ihren unglaublich präzisen, altmeisterlich gemalten Bildern wirkt vieles gleichermaßen beseelt wie dämonisch überformt, immer bereit, sich ins Schauerliche oder Mythologische zu transformieren. Ihre Gestalten, Motive, Landschaften und Szenarien wirken wie ein Mix aus Hieronymus Bosch, Salvador Dali oder Giorgio de Chirico. Carrington, die als eine der bedeutendsten Vertreterinnen des Surrealismus kanonisiert wird - wohl nicht zuletzt, weil sie eine große und tragische Liebe mit Max Ernst verband -, wird derzeit hoch gehandelt. 2024 erzielte eines ihrer Gemälde 28,5 Millionen Dollar bei Sotheby´s.
Dass ihr ungewöhnliches Leben als Frau und Künstlerin nicht schon längst verfilmt wurde, verwundert. Denn es beinhaltet alles, was ein spannendes Biopic braucht. Jetzt aber ist es soweit: „Leonora im Morgenlicht“ (Regisseur: Thor Klein) kommt in die Kinos. Der Film basiert auf dem Roman (!) „Frau des Windes“ der mexikanischen Schriftstellerin Elena Poniatowska. Ein aufwendig produzierter Film, was Kulissen, Kostüme und Drehorte anbelangt. Nur leider kann die britische Star-Schauspielerin Olivia Vinall in der Hauptrolle ebenso wenig überzeugen wie die holprige Narration mit ihren zahlreichen inhaltlichen Lücken und Sprüngen. So findet der Film weder einen roten Faden noch einen Rhythmus. Hinzu kommen Dialoge, die hölzerner und läppischer nicht sein könnten. Auch dass kein einziges Gemälde im Film gezeigt wird, was wohl den Bildrechten geschuldet ist, wirkt sich negativ aus. Das Ganze ist einfach unerträglich und ganz kruder Kitsch.

Aber selbst ein komplett missratener Film kann etwas Positives auslösen. Man kommt aus dem Kino und möchte unbedingt mehr erfahren. Wer war also diese Frau?
Leonora Carrington kam 1917 als Tochter eines schwer reichen Textil- und Chemiefabrikanten und seiner irischen Gattin im Nordwestern Englands auf die Welt. Sie wuchs in einem alten burgartigen Gemäuer auf, betreut von einem irischen Kindermädchen, dessen keltische Sagen- und Märchenerzählungen auf fruchtbaren Boden fielen. Schon früh zeigte sie Kreativität und zeichnerisches Talent. Mit 19 widersetzte sie sich den Plänen ihrer Eltern. Sie ging nach London, um Malerei zu studieren. Dort lernte sie den doppelt so alten Max Ernst kennen und lieben, und folgte ihm nach Paris, was den endgültigen Bruch mit der Familie bedeutete. „Never will my door be darkened by your shadow“, sprach der Vater und drehte unverzüglich den Geldhahn zu.
In Paris lernte Leonora Carrington nicht nur Picasso oder Giacometti, sondern vor allem André Breton, Man Ray, Miró, Dali und Luis Buñuel kennen - all die berühmten Männer, die sich dem sogenannten Surrealismus verschrieben hatten. Man kämpfte mit viel Lust am Experiment und an Grenzüberschreitungen gegen Mal- und Denktraditionen, gegen Verkopftheit, aber auch gegen das Establishment mit seinen bürgerlichen Normen. Vor allem jedoch setzten die Surrealisten auf die Kraft der Träume und Fantasien, auf die Einfälle des Unbewussten. Und da war Leonora Carrington genau richtig. Die junge, schöne, kluge und humorvolle Engländerin wurde schnell nicht nur für ihre technisch hervorragenden Bilder bekannt, sondern auch für ihre ungewöhnlichen Auftritte und Einfälle. Mal schockierte sie auf einer Party mit einer Strip-Einlage, ein anderes Mal bestrich sie ihre Zehen in einem vornehmen Pariser Lokal mit Senf. Und nie ließ sie zu, als Anhängsel oder Muse von Max Ernst verstanden zu werden. Denn selbst in der so unorthodoxen Gruppe der Surrealisten existierten Frauen vor allem als schöne Musen, als Stimulanz für männliche Kreativität.
Leonora und Max waren vier Jahre lang ein Paar. Zunächst lebten sie in Paris, ab 1937 dann in einem einsamen Steinhaus in Saint-Martin d´Ardèche, wo sie ihr eigenes Paradies schufen. Es entstanden Bilder, Wandbemalungen und Skulpturen, aber auch zahlreiche Texte. Hinzu kam die Beschäftigung mit Magie, mit Astronomie und Alchemie. Als Max Ernst wiederholt von den Nazis aufgegriffen und interniert wurde, führte dies bei Leonora Carrington zu einem Nervenzusammenbruch. Auf Veranlassung ihres Vaters, der als internationaler Unternehmerüber über viele Kontakte verfügte, wurde die umherirrende Künstlerin in Spanien aufgegriffen und in die Psychiatrie eingewiesen. Die damals verbreiteten „Therapien“, Elektroschocks und Spritzen mit Cardiazol, lösten bei ihr Horrorvisionen, Wahnzustände und Todesängste aus. In dem Text „Unten“ und dem Dreiakter „Das Fest des Lamms“ beschreibt sie die grauenhaften Behandlungen und ihre Konsequenzen. Mittels einer Scheinehe gelingt Carrington dann die Flucht, zunächst nach New York und später nach Mexiko, wo sie unter anderem auch in der Frauenbewegung aktiv war, bis sie 94-jährig in Mexiko City verstarb.

Schamanismus, die Maya-Kultur bzw. die mexikanischen Mythologien, die keltischen Sagen, aber auch C. G. Jungs Archetypenlehre oder der tibetische Buddhismus fanden Eingang in ihre Bilder und Schriften.
Folgendes Zitat aus dem Jahr 1975 soll diesen kleinen Text über diese großartige Künstlerin abschließen, der man wirklich von ganzem Herzen ein besseres Biopic gewünscht hätte: „Wir sind dabei die Erde zu zerstören, bevor wir überhaupt etwas über sie wissen. Vielleicht kann die Neugier, eine große Tugend, dann zufrieden gestellt werden, wenn wir die Myriaden falsch gesammelter Daten einfach auf den Kopf stellen und kein Ding geringschätzen, keines ignorieren ….und versuchen eher rückwärts zu laufen“.
Leonora im Morgenlicht
Originaltitel
Leonora in the morning light
Kinostart: 17.07.2025
Titel zum Thema Leonora Carrington:
Leonora im Morgenlicht - Das Biopic über die großartige Künstlerin Leonora Carrington
Filmbesprechung und Portait: Leonora Carringtons fantastisches Oeuvre, aber auch ihr, gelinde gesagt, turbulentes Leben gilt es (wieder) zu entdecken.

Galerie Parterre

neue Gesellschaft für bildende Kunst (nGbK)

Galerie im Körnerpark

Haus am Kleistpark | Projektraum
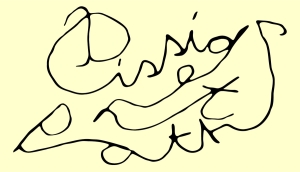
neue Gesellschaft für bildende Kunst (nGbK)