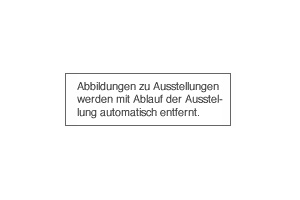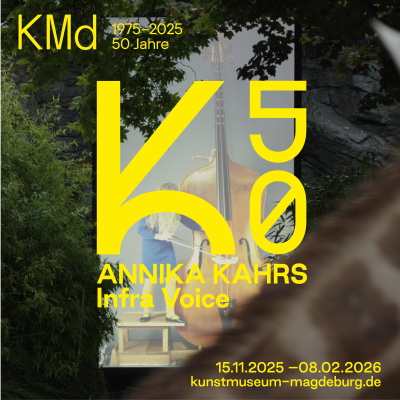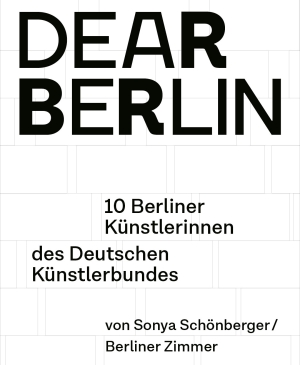Die Retrospektive zu Fluxus-Künstler Tomas Schmit im Neuen Berliner Kunstverein (n.b.k.) zeigt, wie sich Performance und Aktion heute begründen - Shilpa Gupta zeigt, dass aus der Kunst heute das Performative nicht wegzudenken ist.
“Wir bedauern außerordentlich, Sie dazu gebracht zu haben, 3 Stunden und 14 Minuten nutzlos zu vergeuden, für Kunst zu vergeuden! Sie haben durch uns 3 Stunden und 14 Minuten der Realität verpasst!!! Im tiefsten Bedauern und hochachtungsvoll! Tomas Schmit.” Geschrieben auf Schreibmaschine, die Zahlen nachträglich handschriftlich ergänzt, offenbart sich im umfangreichen Dokumentationskatalog des Aktions- und Konzeptkünstlers ein durchdringender Humor. Akribisch brachte Schmit das Nagen an einer Gesellschaft zu Papier, die im Zuschauen erstarrt zu sein schien. Anfang der 1960er Jahr lernte er über den Medienkunstpionier Nam June Paik George Maciunas und die Fluxus-Bewegung kennen. In den folgenden Jahren prägte Tomas Schmit entscheidend jene Bewegung, die sich gegen ein elitäres Kunstverständnis richtete und den Fokus vom Kunstwerk auf das Konzept verlegte. Spürbar erzürnt berichtete eine Fernsehreportage über die Ausstellung 24 Stunden, die Schmit am 5. Juni 1965 mit unter anderem Joseph Beuys, Charlotte Moorman und Bazon Brock in der Wuppertaler Galerie Parnass inszenierte: Als “Gaukler, Geißler und Asketen” werden sie dort zusammengefasst – fast wünschenswert erscheinen die fassungslosen Blicke des Publikums, die eine Aktion von Brock begleiten.
Die Ausstellung Tomas Schmit. Stücke, Aktionen, Dokumente 1962–1970 bringt zusammen, was vielleicht erst im Rückblick in seiner Komplexität verstanden werden kann. Auf unzähligen DIN A 4 Seiten tippte Schmit die Konzepte für seine Aktionen und plante sie bis ins kleinste Detail. Die Dokumente aus dem Nachlass des Künstlers – heute im Besitz des tomas schmit archivs – zeigen, dass nichts dem Zufall überlassen ist. Für jede Situation gab Schmit eine konkrete Handlungsanweisung. Für seinen Zyklus für Wassereimer (1962) sollten sich Künstler*innen in einem Kreis von zehn bis dreißig Wasserbehältnissen positionieren und Wasser solange von einem Eimer in den nächsten gießen, bis dieses verbraucht ist. Für die Aktion ohne Publikum (1965) im Rahmen der Ausstellung 24 Stunden vermerkte Schmit: “Sobald das Publikum den Raum betritt, wird die Aktion unterbrochen und erst wieder aufgenommen, sobald das Publikum den Raum wieder verlassen hat. Dem Publikum ist es unmöglich, die Aktion sensuell mitzuerleben. Nur das Erleben der gestoppten Aktion ist dem Publikum möglich (eine Aktion lässt sich tun, nicht erleben).” Es ist die überlegte, gestochen scharfe Sprache des Künstlers, die im Kopf unweigerlich Bilder entstehen lässt – sie macht das Immaterielle seiner Aktionen sichtbar, gibt vermeintlich flüchtigen Momenten eine universelle Beständigkeit. Wie die sorgfältig einstudierte Choreografie einer Ballettinszenierung verleiht Schmit seinen Aktionen durch die Verschriftlichung Leichtigkeit. Während ihrer Dauer tritt alles Gegenständliche in den Hintergrund: Es gibt kein Kunstwerk, das betrachtet werden kann – nur die Handlung selbst und die Reaktion darauf. Die Vorstellung, dass ein an Ausstellungsräume gewohntes Publikum der 1960er in Anbetracht so wenig Greifbarem getobt haben muss, amüsiert.
Vervollständigt wird das Bild von Fluxus durch die Berichterstattung aus den Medien und Publikationen: Fernsehbeiträge, Magazine, Ausstellungsplakate. Dazwischen interpretieren Künstler*innen wie Harun Farocki die Arbeiten Schmits neu. Letzterer lässt in einem Video einen Roboter Wasser von Flasche zu Flasche schütten. Begrüßt werden Besuchende im n.b.k. von Zeitgenosse Gerhard Rühm, der Schmits Anstelle von, eine Veranstaltungsverunstaltung (1964) eingelesen hat und in Dauerschleife die Worte “Gehen Sie nach Hause!” wiederholt. Die künstlerischen Interpretationen scheinen wie Kommentare – als Wertschätzungen einer nach wie vor prägenden Bewegung. In der Kunst geht es immer um Grenzüberschreitungen. Wie die Reaktion des Publikums erzwungen werden kann, zeigen die Arbeiten von Tomas Schmit auf charmante Weise. Als Besuchende der Ausstellung fühlen wir uns überlegen – kennen wir doch bereits Anfang, Ende und Ziel einer jeden Aktion. Doch in einer Zeit, die permanent neue und radikalere Grenzüberschreitungen auszuhandeln scheint, hallt das Lebenswerk Schmits wie auch der Fluxus-Bewegung nach: als eine Kunst, die sich jeglichem Materiellen entzieht. Ob Christoph Schlingensiefs Container für Geflüchtete vor der Wiener Staatsoper, Anne Imhofs Performance im deutschen Pavillon während der 57. Biennale in Venedig oder das Zentrum für politische Schönheit – immer wieder sind es Aktionen, bis ins Detail geplant und kaum sichtbar, die starke Emotionen auszulösen vermögen und eine Auseinandersetzung einfordern. Das Performative und Einbeziehende berührt, lässt innehalten und stößt Diskurse an, wie wir sie auf jeder gesellschaftlichen Ebene dringend benötigen.
Von dieser Freiheit in der Kunst – eine Freiheit, die sie von anderen Gestaltungsformen unterscheidet – leben auch die Arbeiten der indischen Künstlerin Shilpa Gupta, die im Showroom des n.b.k. im ersten Stock zu sehen sind: Eine Anzeigetafel im Zentrum des Raums, wie sie in alten Bahnhofshallen oder an Flughäfen manchmal noch zu finden ist, spielt mit der Vorstellungskraft. Buchstaben werden für Words Come from Ears (2018) im Sekundentakte ausgewechselt, formieren sich zu immer neuen Zeilen eines sich pausenlos fortsetzenden Gedichts. In Glasflaschen spricht sie für die fortlaufende Reihe For, in Your Tongue, I Cannot Fit kontinuierlich Zeilen von Dichter*innen, die in ihrer Heimat für ihre Arbeit inhaftiert wurden. Ein Gedicht Nâzım Hikmets erinnert an den anatolischen Poeten, der 1963 im Exil starb und in der Einleitung den Wunsch äußert, unter einer Platane in seinem Heimatdorf begraben zu werden. Gupta fordert in ihrer Arbeit jene auf, die nach seinem Tod ein Stück eines Fotos, welches das Grab Hikmets zeigt, dieses wieder zusammenzusetzen. Nur wenige Bildfetzen deuten das Foto an, ein Haufen Nadeln liegt bereit, um dieses zu vervollständigen. Wie bei der Aktionskunst ist es die Abwesenheit des Sichtbaren, die einen Missstand und eine politische Dynamik allein in der Vorstellung zu Leben erwecken. Die Kraft und Freiheit liegen nicht in den Objekten vor Ort, sondern in der Realisation.
Die Retrospektive Tomas Schmit. Stücke, Aktionen, Dokumente 1962–1970 ist noch bis zum 23.01.2022 im n.b.k. zu sehen.
Die Arbeiten von Shilpa Gupta werden bis zum 21.01.2022 gezeigt.
Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestraße 128/129
10115 Berlin
www.nbk.org