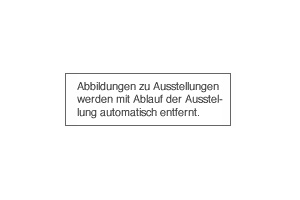Diesmal schreibe ich über etwas, worüber in unserer Gesellschaft nur ungern gesprochen wird: über Geld. Ich habe Geld – bis Mitte kommenden Jahres 1.400 Netto im Monat. Ich wohne allein und günstig. Von diesem Geld muss ich niemanden mitfinanzieren, nicht einmal ein Haustier. Abzüglich fixer Nebenkosten stehen mir runde 650 Euro jeden Monat frei zur Verfügung. Ich bin privilegiert. Ich bin weiß, männlich und habe einen deutschen Pass, keine körperlichen Leiden oder Krankheiten.
Aus dieser Perspektive schreibe ich über die Rauminstallation Frauenbank Berlin von Irena Haiduk im 1. Geschoss des n.b.k. Berlin. Teil dieser Arbeit ist Das Epos der Berliner Frauenbank erzählt von der Politologin Gilla Dölle und ihrer Forschung zu finanziellen Aspekten der deutschen Frauenrechtsbewegung.
Irena Haiduk ist Mitbegründerin des Unternehmens Yugoexport, dessen hässlicher Namensvetter der jugoslawische Bekleidungs- und Waffenhersteller Jugoeksport ist.
Aber Yugoexport ist zum Glück freundlicher. Ding und Mensch sind hier gleichwertig, der Slogan lautet „How to Surround Your Self With Things in the Right Way“ (Wie man sich auf die richtige Weise mit Dingen umgibt). Das künstlerisch-performative Unternehmen stellt unter anderem Bilder, Bücher, Kleidung und Szenografien her. So können vor Ort für einen auf dem Einkommen der Käufer*innen basierenden Preis über den n.b.k. Yugoexport Work Shirts (2021) – Arbeitshemden erworben werden. Die Einnahmen dienen dann wiederum einer nachfolgende Publikation über die Geschichte und das Erbe der Berliner Frauenbank.
Vor dem Ausstellungsraum steht eine Kerze. Ich muss sie vor Betreten des Raumes anzünden, als Zeichen. Ich gehe hinein. Der Raum ist jetzt besetzt. Im Inneren ummantelt mich eine dunkle Körperlichkeit.
In einer Wand sind drei Öffnungen eingeschnitten, kleine organische Löcher. Ihre Laibung ist tief und macht die Dicke der Wand erfahrbar. Sie wirkt fleischig wie eine Fettschicht, ist hautfarben, glänzt, ist hart und klingt leicht. Ich bin im Inneren. Es ist ein Erinnerungsort.
Gedacht wird hier an die genossenschaftlich organisierte Frauenbank. Sie wuchs 1910 aus der Berliner Frauenbewegung. Sie wurde von Frauen getragen, war genossenschaftlich organisiert und akzeptierte ausschließlich Kundinnen. Diese Setzung war wichtig, weil Frauen damals nicht eigenständig über ihr Geld verfügen konnten. Sie waren angewiesen auf die Erlaubnis ihrer Eltern, eines Vormunds oder des Ehepartners. Doch die Frauenbank nahm die Sparguthaben auch ohne diese Genehmigungen an. Parallel zu den Bankgeschäften wurden Rechtsberatungen angeboten und die Zeitschrift Frauenkapital – Eine werdende Macht herausgebracht.
Bereits früh wurde das Unternehmen skeptisch von der männlich geprägten Wirtschaftsdomäne beäugt. Verleumdungen brachten das Unternehmen 1916 schließlich zum Einsturz. Es folgte ein Konkursverfahren. Die Prozessakten und Gerichtsurteile sowie die Geschäftsunterlagen sind leider nicht überliefert.
Die drei Fenster sind in eine rund ein Meter massive Wand geschnitten. Ich schaue aus dem Inneren auf die Chausseestraße. Da sind Bioläden, teure Möbelgeschäfte und Neubauten wie das Am Tacheles. Dort ist unsere Realität, sozusagen die gebaute Materialisierung heutiger Wirtschaftslogik. Diese fordert Wachstum, bedingungslos. Doch hier im Inneren scheinen mich die dicken Wände vor dem Äußeren zu schützen. Hier ist es dunkel und ganz leise, aus einer tiefen Quelle höre ich uneindeutige Geräusche. Die abstrakten Töne werden lauter, sie erinnern mich an Rauschen, mehr an Stimmungen. Haiduk setzt auf das Akustische, als einen Anfang unsere Wahrnehmung, unsere Wünsche, unsere sinnliche Ökonomie neu zu denken. Weg von der überreizenden Bilderflut, weg von Plakaten, die um Aufmerksamkeit buhlen, mit zwielichter Bildsprache, und weg von einer Architektur, die nur überteuerte Retorten produziert. Weg vom (patriarchalen) Kapitalismus. Mit dem Klang, dem akustischen Sinn formuliert Haiduk mehr als einen ungewöhnlichen Ansatz. Sie schreibt sich damit in eine lange Traditionslinie des Oralen ein, einer Ökonomie, die sich immer wieder dem als männlich konzipierten Logos entzog und ihn unterlief.
Das Raumkunstwerk wirft Fragen auf. Einzelne Gestaltungselemente werden nicht weiter erklärt. Sie bleiben offen.
Und so verlasse ich den Raum nach einiger Zeit. Mache die Kerze aus. Lege das Streichholz in einen Aschenbecher. Vor mir im Vorraum befindet sich die hauseigene Artothek, wo Kunstwerke auch an private Leute gegen Geld verliehen werden. Möglicher Beginn einer genossenschaftlichen Teilung, im Sinne des Allgemeinguts? Oder bloß der Notbehelf eines Kunstortes, der mit dem Kapitalismus wetteifern muss?
Diskursprogramm
8. März 2022
Das Epos der Berliner Frauenbank
Erzählt von Gilla Dölle (Politologin, Mitbegründerin Archiv der deutschen Frauenbewegung, Kassel), auf der Website des n.b.k.
April 2022
Künstleringespräch
Mit Irena Haiduk und Darby English (Professor für Kunstgeschichte,
University of Chicago), der Termin wird auf www.nbk.org bekanntgegeben.
In englischer Sprache
30. April 2022, 21 Uhr
Yugoexport. Cabaret Économique
Performance mit Irena Haiduk, Dean Kissick (Autor und Redakteur, Spike Magazine, New York), Christian Schmitz (Musiker und Komponist, Berlin), u. a.
Ort: Anita Berber, Pankstraße 17, 13357 Berlin
Tickets ab April im Vorverkauf unter www.nbk.org
Einlass: 20 Uhr / Performance 21:00 Uhr
Irena Haiduk. Frauenbank Berlin
4. März – 1. Mai 2022
Neuer Berliner Kunstverein
Chausseestraße 128/129
10115 Berlin
Dienstag – Freitag 12–18 Uhr
Donnerstag 12–20 Uhr
www.nbk.org