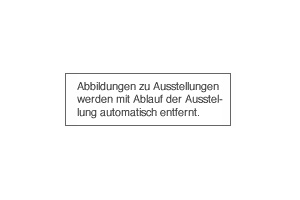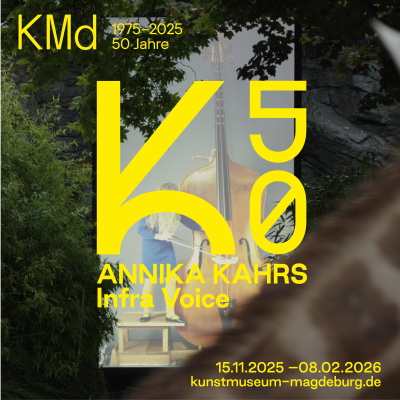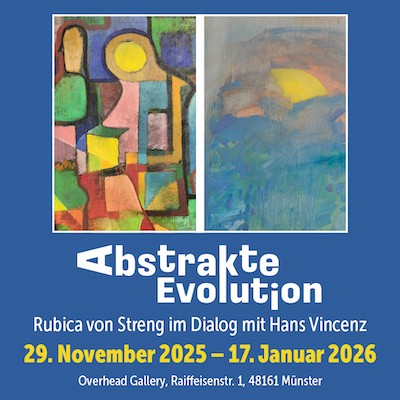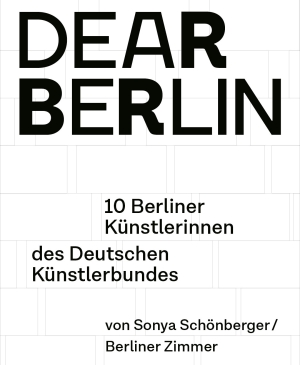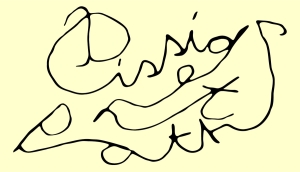Die aquamediale ist ein internationales Festival für zeitgenössische Kunst im Spreewald. In diesem Jahr findet das Kunstfestival zum 16. Mal statt. Wie immer geht es um hochaktuelle Themen unserer Zeit. So lautet das diesjährige Motto biodiversity, das die Auswirkungen einer gestörten Balance zwischen Mensch und Natur thematisiert.
Aus einem Open Call heraus bewarben sich 204 Künstler:innen aus 10 Nationen, 10 wurden für die aquamediale 16 ausgewählt. In Zusammenarbeit mit dem Kurator Harald Larisch sind nun die vor Ort realisierten Kunstwerke im Biosphärenreservat um Lübben zu sehen.
Über die Dauer des Festivals (31. Mai bis 27. September 2025) stellen wir auf art-in-berlin in regelmäßigen Abständen die Künstler:innen in Kurzinterviews vor.
INTERVIEW
Jahna Dahms hat Kunstgeschichte, Geschichte und Philosophie an der Technischen Universität Dresden sowie Bildende Kunst an der Hochschule für Bildende Künste Dresden studiert. Sie reflektiert in ihren Installationen, Skulpturen, Zeichnungen und Objekten universale, kulturelle und historische Themen.
Carola Hartlieb-Kühn: Liebe Jahna Dahms, die diesjährige aquamediale steht unter dem Motto „Biodiversität“. Sie zeigen die Serie Relics. Von Gold und Wasser geformt. Welche Idee verbindet Ihre Arbeit mit dem Motto?
Jahna Dahms: Biodiversität beschreibt in der Biologie komplexe, miteinander verwobene Systeme. Dieser Gedanke lässt sich auf kulturelle Ausdrucksformen übertragen. Mit Relics interpretiere ich Biodiversität als kulturelle Vielfalt, als Netzwerk von Formen, Symbolen und materiellen Überlieferungen. Die Werkgruppe Relics lässt sich als künstlerische Annäherung an diese kulturelle Tiefenstruktur verstehen, wobei der Titel Relics. Geformt aus Gold und Wasser auf eine organisch anmutende, fast natürliche Entstehung verweist - obwohl die Objekte aus industriellen Materialien gefertigt sind. Meine Arbeit erinnert daran, dass jede Kultur oder Epoche Spuren hinterlässt und regt zum Nachdenken über unseren ökologischen Fußabdruck und unsere kulturelle Verantwortung an. Biodiversität wird so auf kultureller Ebene verhandelt, als eine Frage nach Vielfalt, Vernetzung und der Fähigkeit, Komplexität wahrzunehmen und zu transformieren.
Carola Hartlieb-Kühn: Könnten Sie uns den künstlerischen Entstehungsprozess der Arbeit beschreiben?
Jahna Dahms: Am Anfang steht eine Sammlung von industriell gefertigten Styroporverpackungen, die mich in ihrer ruhigen Formensprache an Kultobjekte vergangener Epochen erinnern. Ich ordne und untersuche sie nach formalen, historischen und kulturellen Kriterien. Die Verpackungen werden nicht umgestaltet, sondern neu gelesen. Für jede Ausstellung wähle ich gezielt Formen aus, die mit dem jeweiligen Ort oder der Sammlung korrespondieren. Die anschließende Vergoldung mit 24 Karat Blattgold verändert den Charakter der Objekte. Meine Arbeit basiert auf Sammlung, Analyse und Kontextverschiebung. Relics funktioniert in diesem Sinne mit einem erweiterten Ready-Made-Begriff: Die Objekte werden nicht entworfen, sondern als vorgefundene Formen interpretiert und in ein kulturelles Bedeutungssystem überführt. Ihre ursprüngliche Funktion tritt in den Hintergrund – die Form wird kulturell neu verortet.
Carola Hartlieb-Kühn: Relics, das heißt Relikte, aber auch Reliquien. Was bedeutet der Begriff in Ihrem künstlerischen Werk?
Jahna Dahms: Der Begriff verbindet zwei Ebenen: Relikte als archäologische Überreste, Reliquien als Objekte mit spiritueller Aussage. Beide erhalten ihre Relevanz nicht aus sich selbst heraus, sondern durch kulturelle Zuschreibungen. Genau dieser Prozess interessiert mich: dass Bedeutung erzeugt wird durch Auswahl, Kontext und Interpretation. Die Industrieverpackungen, mit denen ich arbeite, sind funktionale Objekte. Durch Systematisierung, Kontextverschiebung und Vergoldung transformiere ich sie in ihrer Lesbarkeit und Deutung. Relics verweist auf das Potenzial industrieller Formen als archäologische Zeugnisse der Gegenwart und als Projektionsfläche kultureller Aufladung.

Carola Hartlieb-Kühn: Was bedeutet für Sie die Vergoldung der Verpackungselemente?
Jahna Dahms: Gold ist ein kulturell aufgeladenes Material. Es steht für Transzendenz, Dauer, Licht. In vielen Kulturen war es nicht für den Alltag bestimmt, sondern diente als Verbindung zu einer jenseitigen, göttlichen Welt. Mich interessiert diese symbolische Dimension. Die Vergoldung verändert die Wirkung der Objekte, sie wandelt die Ausdrucksform grundlegend. Ein banaler Gegenstand beginnt sich mit Artefakten anderer Epochen zu verbinden: durch Material, Wirkung, Farbe. Gold wird zum Medium der Verwandlung.
Carola Hartlieb-Kühn: Inwiefern stehen Ihre Arbeiten mit ökologischen Fragestellungen in Verbindung?
Jahna Dahms: Was bleibt, wenn wir längst vergangen sind? Was wird überdauern? Polystyrol ein Produkt aus Erdöl, dem „schwarzen Gold“ unserer Zeit, zersetzt sich nur sehr langsam. Es braucht Jahrtausende, um abgebaut zu werden. Diese Materialeigenschaft macht es zu einem möglichen Zeitzeugen. Relics stellt also nicht nur eine ästhetische, sondern auch eine materielle Frage an die Zukunft. In der Transformation durch Vergoldung werden industrielle Verpackungen zu Relikten – nicht als Kommentar zur Wegwerfgesellschaft, sondern als Einladung, über Dauer und kulturellen Wert nachzudenken. Die Arbeit verbindet eine ökologische Perspektive mit einer Reflexion über globale Formtraditionen. Die Relics werden so zu einer Bestandsaufnahme unserer Epoche.
Carola Hartlieb-Kühn: Sind Sie im Hinblick auf Ihre Materialtransformationen immer noch an alchemistischen Prozessen interessiert?
Jahna Dahms: Alchemie interessiert mich als Denkhaltung – als Verbindung von Beobachtung, Materialkenntnis und Neugier. In der Renaissance war die Alchemie eine frühe Form der Wissenschaft – eine Sichtweise, die durch genaues Beobachten und Experimentieren ein Verständnis der Welt entwickelte. Frei von festen Methoden, aber ernsthaft in der Suche. Ich arbeite auch mit einer gewissen Freiheit und Naivität – im besten Sinne –, weil künstlerische Prozesse genau diesen Spielraum brauchen: zwischen Intuition und Analyse, zwischen Gewissheit und Offenheit. Transmutation ist vielleicht der Schlüsselbegriff der Alchemie. Er kann chemisch, physikalisch, aber auch ideell verstanden werden. Bei Relics ist die Vergoldung nicht einfach eine Veredelung, sondern eine Deutungsverschiebung. Gold verändert die Wahrnehmung, vor allem aber die Lesart und das Verständnis der Form. In diesem Sinne ist Relics vielleicht ein alchimistisches Projekt.
Carola Hartlieb-Kühn: Welche Rolle spielt die Archäologie in Ihrer künstlerischen Praxis?
Jahna Dahms: Mein Studium der Ur- und Frühgeschichte, Kunstgeschichte und Philosophie prägt meine Arbeit bis heute. Ich arbeite mit zeichnerischer Dokumentation, typologischer Ordnung und Systematisierung – mit Methoden, die aus der Archäologie bekannt sind. Die Verpackungsobjekte werden mit der gleichen Sorgfalt behandelt wie Fundstücke: analysiert, geordnet, in kulturelle Kontexte gestellt. Ich betrachte sie mit dem Blick einer späteren Zeit, denn sie haben das Potenzial, Jahrtausende zu überdauern. In ihren Formen liegt eine universelle Bildsprache, die historische, kulturelle und symbolische Kontinuitäten sichtbar macht. Die Gegenwart kann so gelesen werden, als sei sie bereits vergangen. Und gerade darin entsteht eine neue Art von Nähe mit einem Blick auf das Alltägliche, der sonst oft fehlt.

Carola Hartlieb-Kühn: Während Ihres Studiums der Kunstgeschichte sind Sie wahrscheinlich auch auf den Begriff der „Pathosformeln“ von Aby Warburg gestoßen...
Jahna Dahms: Warburgs Denken ist ein Schlüssel zu meinem Verständnis von Bild, Form und kulturellem Transfer – nicht nur kunsthistorisch, sondern auch als Grundlage meiner künstlerischen Praxis. Sein Ansatz, Bildtraditionen nicht isoliert, sondern in Bewegung zu betrachten, kommt mir sehr nahe. Der Mnemosyne-Atlas begreift Bildkultur als dynamisches Feld – voller Wiederkehr, Verschiebung und Resonanz. Diese Offenheit zwischen wissenschaftlicher Systematik, Intuition und poetischer Ordnung inspiriert meine Arbeit. Auch Relics denkt nicht in formalen Zitaten, sondern in strukturellen Ähnlichkeiten als Ausdruck einer universellen Gestaltungslogik. Verpackungsformen werden nicht rekonstruiert, sondern auf ihre Anschlussfähigkeit an historische Artefakte hin gelesen. Neben Warburg ist Jan Assmanns Konzept des kulturellen Gedächtnisses für meine Arbeit wichtig ebenso wie Georg Kublers Idee, Form als Sequenz über Epochen hinweg zu verstehen. Meine Arbeit begreift industrielle Objekte als Teil solcher historischen Formketten, als Spuren, nicht als Rückgriffe. Diese Perspektive prägt meine künstlerische Praxis ebenso wie meine theoretische Arbeit an einer universellen Formensprache.
Carola Hartlieb-Kühn: Wie fügt sich Relics in Ihr gesamtes künstlerisches Schaffen ein, und gibt es einen Moment in dieser Arbeit, den Sie auch in Zukunft weiter erforschen werden?
Jahna Dahms: Relics ist Teil einer langjährigen Auseinandersetzung mit universellen Formensprachen, die sich in verschiedensten Kulturen und Epochen zeigen. Dieser Gedanke durchzieht mein gesamtes Werk in Zeichnungen, installativen Arbeiten und konzeptuellen Objektgruppen. Die Verpackungsformen werden zu Untersuchungsobjekten, deren Gestalt an rituelle Artefakte erinnert – obwohl sie aus einem vergänglichen Material bestehen. Daraus ist die Bibliothek der Formen entstanden: eine Sammlung unvergoldeter Styropor-Objekte, geordnet nach eigenen Prinzipien – Typologien, formale Struktur, Provenienz. Ich verstehe dieses Archiv als eine langfristige künstlerische und theoretische Arbeit. Es folgt der Idee einer vergleichenden Formanalyse. Relics und die Bibliothek der Formen werden gemeinsam zum Ausgangspunkt für weitere Ordnungen, Recherchen, Zeichnungen, Kontexte – und für ein Nachdenken über unsere Gegenwart.