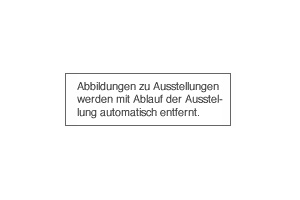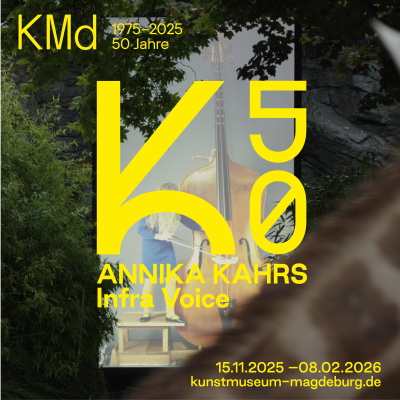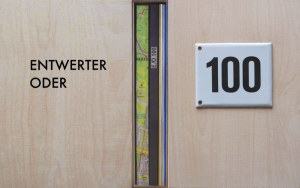Amanda Kims Portrait über das Leben des revolutionären koreanischen Videokünstlers Nam June Paik, dem es gelang, eine völlig neue Kunstform zu erfinden, ist facettenreich, kurzweilig und informativ.
Wie steinig, kräfteraubend und phasenweise aussichtslos das war, was Nam June Paik Zeit seines Lebens verfolgte, macht der Film ebenso deutlich wie die politische Ausrichtung seines Wirkens. Für Paik war Video ein Medium, welches das Künstlerische mit dem Politischen unmittelbar zusammenbrachte. Zunächst ging es jedoch darum, dass Videokunst überhaupt als Kunstform anerkannt wurde - eine Kunst, die an keinerlei Traditionen oder Vorbilder anknüpfen konnte, sondern in den 1960er und 70er Jahren neu, provozierend, verwirrend und für viele komplett unverständlich war. Die zahlreichen, abwechslungsreich montierten Kommentare von Zeitgenossen, Wegbegleitern, Galeristen und Kritikern machen dies deutlich, laden ein zum Schmunzeln, aber vor allem zum Nachdenken.
Der Film geht dabei weitgehend chronologisch vor, beginnend mit den 1950er Jahren, als Paik, überzeugter Marxist, in Ablehnung seiner schwerreichen südkoreanischen Familie nach Deutschland auswanderte, um Musik zu studieren. Vor allem Arnold Schönberg war es, dessen Kompositionen den jungen Paik faszinierten. Dann folgten Begegnungen mit Karlheinz Stockhausen und John Cage, der zeitlebens sein Freund bleiben sollte. Die beiden Künstler vereinte die Idee, gegen das Establishment zu agieren, gegen jedwede Form des althergebrachten Kunstverständnisses, gegen die Ideologie der westlichen Welt mit ihrem Kolonialismus, Kapitalismus, Konsumismus und verstecktem Nazismus.

Zu seinen Weggefährten der damaligen Zeit zählten neben Cage vor allem Joseph Beuys und Künstler der Fluxus-Bewegung. Paik experimentierte, baute Klanginstallationen, provozierte mit Performances. Es folgte 1963 die erste Ausstellung in der wuppertaler Galerie Parnass, bei der Paik die Galerieräume mit vielen Fernsehgeräten bestückte, deren Bilder er durch die Einwirkung von Magneten veränderte und verfälschte. Die Aktion stieß auf komplettes Unverständnis der Kunstkritik, wie der Grandseigneur Bazon Brock rückblickend erinnert. Doch entscheidend war die Tatsache, dass er 1965 in Japan den ersten Portapak Videorekorder erwerben konnte. Diese Technik brachte ihn auf neue künstlerische Wege.
Paik war es, der als erster überhaupt das Potential der Videotechnik erkannte. Eine Technik, die einfach handhabbar und bezahlbar war, vor allem jedoch mit der ungeahnten Möglichkeit, TV-Bilder elektronisch selbst zu bearbeiten. Und: quasi dialogisch zu agieren. Denn davon war Paik zutiefst überzeugt: „talking back is what democracy means“. Eines von zahlreichen markanten Zitaten, die den Film strukturieren.
Die Fluxus Bewegung bzw. Deutschland brachte den Künstler jedoch nicht weiter, Paik ging nach New York. Dort fand er schnell Anschluss an die Avantgarde, Jonas Mekas, Merce Cunningham, Allen Ginsberg und viele andere gehörten zu seinem Freundeskreis. Der Film zeigt hier diverse Originalaufnahmen bzw. Mitschnitte. Besonders ergiebig war für Paik die Zusammenarbeit mit der Cellistin Charlotte Moorman: Sie brachte zwar die nötige Publicity, aber kein Geld, und es bestand die Gefahr der Ausweisung aus den USA. Paik lebte in dieser Zeit in jeder Hinsicht unsicher. Seine Bittbriefe und die Aufstellung seiner kümmerlichen Ausgaben geben ein anschauliches Beispiel für seine prekäre Lebenssituation damals in New York.
Mit einem selbst entwickelten Color Synthesizer schuf Paik psychedelische, vielfarbige fantastische Bilder, die im krassen Widerspruch zu den kommerziellen Fernsehbildern standen. „I use technology in order to hate it properly”, hört man ihn sagen.

Erst 1974 gelang ihm der Durchbruch mit seinem TV-Buddha, der bis heute als Ikone der Videokunst gilt. Eine religiös konnotierte Figur, die auf ein regloses elektronisches Spiegelbild schaut. Ein Buddha als Medium und Couch Potato - eine Installation, die nur dialektisch verstanden werden kann/will. Paik, der einen PhD in Musik und Philosophie hatte, brachte mit dieser Arbeit seine grundlegenden Ideen auf den Punkt. Der TV-Buddha wurde weltweit verstanden und machte den Künstler endlich berühmt. Es folgten Auszeichnungen, Ehrungen, zahlreiche Einzelausstellungen und Preise. Im Jahr 2000 beeindruckte der inzwischen schwer erkrankte Paik im Guggenheim Museum mit seiner Laser-Kunst, die er als die Kunst der Zukunft ansah. „Jacob´s Ladder“ angelehnt an die biblische Himmelsleiter, die der Erzvater Jakob im Traum sah. Die Verbindung zwischen spiritueller/göttlicher und weltlicher Welt, die Hoffnung auf Transzendenz, das war seine letzte große Botschaft.
Als Nam June Paik 2006 in den USA verstarb, war sein künstlerischer Einfluss bereits seit Jahrzehnten überall spürbar geworden, seine Schriften wurden weltweit rezipiert. Für die künstlerische Praxis der sogenannten Neuen Medien ist er nach wie vor Quelle und Inspiration.
„Moon ist the oldest TV“ motiviert erneut sich mit diesem Künstler, seinem Leben, vor allem jedoch mit seinen Ideen zu beschäftigen.
NAM JUNE PAIK: MOON IS THE OLDEST TV
USA 2023, 109 Min., Englisch/Koreanisch mit deutschen Untertiteln, Regie und Produktion: Amanda Kim; Kamera: Nelson Walker