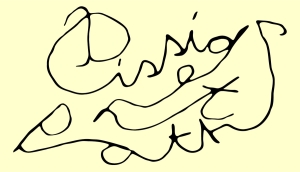Kuratorin Almut Hüfler spricht im Interview mit Frank Lassak über die aktuelle Situation von Frauen im Kunstbetrieb – und über die Ausstellung Die Menschen sind im ganzen Leben blind, die am 17. Oktober im HAUNT eröffnet wird.
Frank Lassak: Wird die Kunstgeschichte gerade im Sinne der Künstlerinnen neu geschrieben, wie es etwa das Magazin Parnass kürzlich postulierte? Kündigt sich nun eine späte Wiedergutmachung an Frauen im Kunstbetrieb an, Frau Hüfler?
Almut Hüfler: Ich würde sagen, das ist ein Trend, der sich aber noch verfestigen muss. Als ich für die Einführungsrede zur Ausstellung Our Voices im Wilhem-Hack-Museum recherchierte, hatte gerade zwei oder drei Tage vorher eine Auktion des Werks Miss January von Marlene Dumas stattgefunden. Bei 13,6 Millionen Dollar fiel der Hammer, damit ist es das teuerste jemals von einer Künstlerin verkaufte Werk. Im Grunde ein großer Erfolg. Aber dann schaue ich auf die Auktionsergebnisse männlicher Künstler und sehe, dass beispielsweise Jeff Koons 100 Millionen Dollar für eine Skulptur einsammelt. Ein signifikanter Unterschied. Die sogenannte Gender Pay Gap schließt sich – wenn überhaupt – sehr langsam. Von Gleichstellung kann kaum die Rede sein.
Lassak: Derlei spektakuläre Verkäufe wie der von Miss January sind demnach eher Ausnahmen?
Hüfler: Im Moment sind es noch Ausnahmen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn sich das ändert. Ohnehin glaube ich daran, dass Trampelpfade immer über einen längeren Zeitraum hinweg entstehen: wenn viele Menschen die gleiche Richtung eingeschlagen. Irgendwann entsteht daraus ein Weg. Wie stark das Missverhältnis heute aber noch ist, zeigt sich in Gender Pay Gap und Gender Show Gap. Dennoch halte ich es für unterkomplex, Ausstellungen zu konzipieren, in denen ausschließlich die Werke von Künstlerinnen gezeigt werden: Wenn man in einer Ausstellung nur Künstlerinnen zusammenstellt, tut sich sofort die biologistische Falle auf. Die Schwierigkeit liegt darin, dass man, um sich für Gleichstellung einzusetzen, eine Differenz behaupten muss. Eine Differenz des Geschlechts, die ja in Bezug auf die Gleichberechtigung gerade überwunden werden soll und die als Vorstellung von eindeutiger Binarität nicht nur wissenschaftlich veraltet, sondern eher Teil eines strukturellen Problems ist.
Lassak: Einige Kuratoren, Kuratorinnen und auch Museen wollen bei der Auswahl der Kunstschaffenden, deren Werke in Ausstellungen gezeigt werden, eine Quote etablieren und im Idealfall gleich viele Künstlerinnen und Künstler berücksichtigen. Was halten Sie davon?
Hüfler: Ich bin keine Dogmatikerin und versuche so gut wie möglich, eine Balance bei den Geschlechtern herzustellen. Meiner Erfahrung nach ist es eben doch eine unterschiedliche Perspektive: Blicke ich als Mann in die Welt oder als Frau – oder als non-binäre Person? Diese Perspektiven dürfen und müssen miteinander in Dialog treten – und nebeneinander stehen. Ich finde das spannend und mich macht das neugierig.
Lassak: Neulich erzählte mir René Zechlin, der Direktor des Wilhelm-Hack-Museums in Ludwigshafen: Wenn er Kuratorinnen beauftrage, dann holen sie dennoch oft Werke männlicher Künstler in die Ausstellungen, weil die meist bekannter seien und mehr Publikum anlockten.
Hüfler: Meine Praxis ist das nicht, da ich an den Wert unterschiedlicher Perspektiven glaube. Bei Ausstellungen, die ich kuratiere, berücksichtige ich neben der Geschlechterdiversität überdies die Alters- und Herkunftsdiversität. Ich finde es grundsätzlich wichtig, das Publikum divers anzusprechen, zumal es auch selbst divers ist. Im besten Fall kommen dann Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven miteinander ins Gespräch. Für mich sind Ausstellungen auch Diskursangebote, begehbare Texte mit unterschiedlichen Argumenten, und die müssen aus mehreren Perspektiven kommen, sonst langweilt mich das. Ich finde es hingegen total reizvoll zu schauen, was passiert, wenn ich eine Ausstellung mit Werken von Künstlerinnen und Künstlern aus unterschiedlichen Kulturkreisen oder Herkunftsländern zusammenstelle? Oft sieht man dann plötzlich das Gemeinsame und das Trennende. Für mich sind das kleine Glücksmomente im Ausstellungsbesuch.
Lassak: Gab es solche Momente auch bei Our Voices?
Hüfler: Das war anders, zumal ich den Auftrag hatte, zum 75-jährigen Jubiläum des Deutschen Künstlerbunds nach dessen Wiedergründung eine Ausstellung zu kuratieren, in der ausschließlich Werke von Künstlerinnen zu sehen waren. Das fand ich natürlich auch spannend, zumal die Tendenz zur Verengung auf die männliche Perspektive, die jahrzehntelang im DKB vorherrschte, überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist.
Lassak: Wir leben in einer Zeit, in der Diversität zwar von vielen Menschen eingefordert wird und erwünscht ist, aber von politischer Seite gerade unerwartet viel Gegenwind bekommt. Haben Sie diesen Gegenwind in der kuratorischen Praxis schon bemerkt?
Hüfler: Zum Glück noch nicht. Aber ich mache mir Sorgen, dass er aufkommen könnte. Etwa in Gestalt von Defunding, also dass Gelder gestrichen oder nicht bewilligt werden, weil die auszustellende Kunst oder das Projekt nicht mit der Ideologie der Geldgeber vereinbar ist. So könnte der künstlerische Betrieb beeinflusst werden. Ab dann fehlt nicht mehr viel, und die eigentliche Aufgabe der Kunst – der freie Diskurs über gesellschaftliche Themen jeglicher Art – wäre nicht mehr möglich. Noch habe ich die Hoffnung, dass es nicht so kommt.
Lassak: In der Ausstellung Die Menschen sind im ganzen Leben blind (Faust II, Mitternacht), die Sie mit Katja Pudor und Andreas Schmid kuratiert haben und die am 17. Oktober im HAUNT eröffnet wird, geht es um die psychologischen Phänomene der emotionalen Blindheit und des Realitätsverlusts – ein jahrtausendealtes Thema, das Sie bei Goethe am Ende seiner große Tragödie über den modernen Menschen sowie in Jonathan Frazers Film The Zone of Interest wiedererkennen. Weshalb ist dieses Thema gerade jetzt wieder diskussionswürdig?
Hüfler: Als Sinnbild für Realitätsverlust und Selbsttäuschung hat die Erblindung in den knapp 200 Jahren seit Faust kaum an Aktualität eingebüßt. Auch heute sind wir trotz aller schlimmen Erfahrungen des 20. und bisherigen 21. Jahrhunderts oftmals blind für gewisse Realitäten – oder blenden aus, was wirklich wichtig ist. Die Ausstellungskonzeption stellte daher die Fragen: Wo und unter welchen Bedingungen zeigen sich Wirklichkeitsfragmentierung und Realitätsverlust, und wie kann der Realitätszugang wiederhergestellt, wie können Sorge und Fürsorge wieder zugelassen werden? Gerade jetzt, da wir als Gesellschaft die bedrohlichen Folgen des neoliberalen Kapitalismus – und seiner Sorglosigkeit bezüglich des Erhalts der Biosphäre – immer deutlicher spüren, kann diese Ausstellung den Besucherinnen und Besucher auf sinnliche Weise Denkanstöße geben.
Almut Hüfler ist freiberufliche Kuratorin. Nach dem Studium der Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte und Anglistik in Tübingen, Berlin und London promovierte sie 2010 mit einer Arbeit zur sprachlichen Vermittlung von Kunst im 18. Jahrhundert. Nach akademischen Forschungs- und Lehrtätigkeiten arbeitete sie als Coach und Kommunikationstrainerin. Sie verfasst seit 2011 Texte für Ausstellungen, Websites und Kataloge, kuratiert seit 2019 Ausstellungen und ist seit 2023 Mitglied im Curatorial Board bei frontviews / HAUNT in Berlin. Zu ihren jüngsten Projekten zählte die Jubiläumsausstellung des Deutschen Künstlerbunds Our Voices. Auf den Spuren bildender Künstlerinnen im Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen.